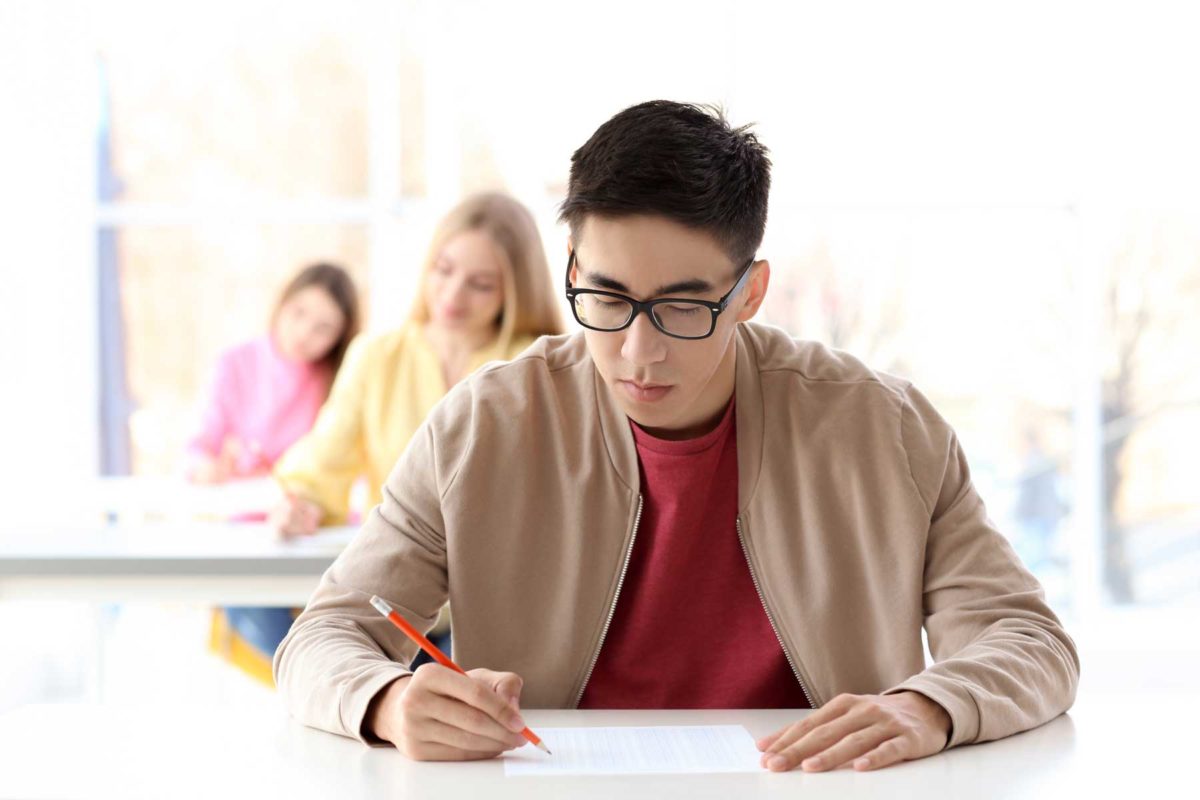Im Deutschen gibt es sechs Kern-Modalverben:
|
|
Zusätzlich wird auch möchten – eigentlich der Konjunktiv II von mögen – im Alltag als eigenständiges Modalverb verwendet, vor allem, um höfliche Wünsche auszudrücken.
Dieser Beitrag gibt Ihnen einen umfassenden Überblick über die Modalverben in der deutschen Sprache: Sie erfahren, was Modalverben sind, wie man sie konjugiert, welche Bedeutungsnuancen sie haben und wie sie im Satzbaueingesetzt werden. Am Ende erwarten Sie außerdem Übungen mit Lösungen, um Ihr Wissen direkt anzuwenden.
1. Was sind Modalverben?
Modalverben sind Verben, die die Bedeutung eines Vollverbs modifizieren. Sie drücken aus, wie der Sprecher eine Handlung oder einen Vorgang einschätzt:
- als möglich („Ich kann gut schwimmen.“),
- als notwendig („Ich muss lernen.“),
- als erlaubt („Du darfst ins Kino gehen.“),
- oder als gewollt („Ich will nach Hause gehen.“).
Ein Modalverb wird konjugiert, während das zugehörige Vollverb im Infinitiv am Satzende steht:
→ „Ich muss jeden Tag Deutsch lernen.“
→ „Wir dürfen heute länger aufbleiben.“
Modalverben können aber auch allein als Vollverb im Satz stehen, wenn der Kontext eindeutig ist oder sie eine eigene Bedeutung tragen:
→ „Ich mag Schokolade.“
→ „Ich muss los.“
Infokasten – Wichtig:
Modalverben heißen auch „modale Hilfsverben“ oder in der Sprachwissenschaft „Präteritopräsentia“. Sie sind unregelmäßig in ihrer Konjugation und nehmen eine Sonderstellung im Satzbau der deutschen Grammatik ein.
2. Übersicht: Die Modalverben im Deutschen
Die sechs Modalverben im Deutschen (plus möchten als Sonderfall) drücken unterschiedliche Bedeutungsnuancen aus. Sie sind unregelmäßig in der Konjugation und treten fast immer zusammen mit einem Vollverb im Infinitiv auf.
| Modalverb | Kernbedeutung(en) |
|---|---|
| dürfen | Erlaubnis, Verbot, Vermutung |
| können | Fähigkeit, Möglichkeit, Erlaubnis, Vermutung |
| mögen | Vorliebe, Gefallen, Wunsch (oft als Vollverb) |
| möchten | höflicher Wunsch, Absicht (Konjunktiv II von „mögen“) |
| müssen | Notwendigkeit, Zwang, Befehl, Schlussfolgerung |
| sollen | Auftrag, Ratschlag, Gerücht, Zweck/Absicht |
| wollen | Wille, Absicht, Weigerung, Fremdaussage |
Hinweis:
- „dürfen“ und „können“ überschneiden sich teilweise bei der Bedeutung „Erlaubnis“.
- „möchten“ wird in der Praxis fast immer wie ein eigenständiges Modalverb verwendet, auch wenn es grammatisch vom Verb „mögen“ abgeleitet ist.
- „sollen“ und „wollen“ können sowohl objektiv (Tatsache) als auch subjektiv (Gerücht, Behauptung) verwendet werden.
Verwendung und Bedeutung der einzelnen Modalverben
„dürfen“
- Erlaubnis/Berechtigung:
→ „Du darfst heute länger aufbleiben.“ - Verbot (mit Verneinung):
→ „Hier darf man nicht rauchen.“ - Vermutung (oft im Konjunktiv II):
→ „Das dürfte richtig sein.“
„können“
- Fähigkeit:
→ „Ich kann gut schwimmen.“ - Möglichkeit:
→ „Das kann passieren.“ - Erlaubnis (ähnlich wie „dürfen“):
→ „Du kannst gerne mitkommen.“ - Schlussfolgerung/Vermutung:
→ „Er kann zu Hause sein.“ - Unmöglichkeit (mit Verneinung):
→ „Das kann nicht wahr sein.“
„mögen“
- Gefallen/Vorliebe (oft als Vollverb):
→ „Ich mag Schokolade.“ - Wunsch/Absicht (häufig in der Form „möchten“):
→ „Ich mag heute nicht arbeiten.“ - Abneigung/Unlust (mit Verneinung):
→ „Ich mag keinen Fisch essen.“
„möchten (Sonderfall)“
- Höflicher Wunsch:
→ „Ich möchte einen Kaffee.“ - Absicht:
→ „Wir möchten bald in den Urlaub fahren.“
Hinweis:
Grammatisch ist möchten der Konjunktiv II von mögen, wird aber im modernen Deutsch im Präsens fast ausschließlich als eigenständiges Modalverb für höfliche Wünsche verwendet.
„müssen“
- Notwendigkeit/Zwang:
→ „Ich muss morgen zum Arzt gehen.“ - Befehl:
→ „Du musst jetzt deine Hausaufgaben machen.“ - Schlussfolgerung:
→ „Das muss die richtige Lösung sein.“
„sollen“
- Auftrag/Aufforderung:
→ „Ich soll dich von ihr grüßen.“ - Gebot/Ratschlag:
→ „Man soll nicht lügen.“ - Gerücht/Fremdaussage:
→ „Er soll sehr reich sein.“ - Zweck/Absicht:
→ „Diese Übung soll dir helfen.“
„wollen“
- Wille/Absicht:
→ „Ich will nach Hause gehen.“ - Weigerung (mit Verneinung):
→ „Das Kind will nicht ins Bett.“ - Fremdaussage (subjektiv, oft mit Zweifel):
→ „Er will davon nichts gewusst haben.“
3. Satzbau und Grammatik mit Modalverben
Die Modalverben haben im Deutschen eine besondere Stellung im Satzbau. Sie bilden zusammen mit einem Vollverb im Infinitiv ein mehrteiliges Prädikat. Gleichzeitig gibt es Sonderregeln für zusammengesetzte Zeiten und für den Gebrauch als Vollverb.
Modalverb + Infinitiv
Das Modalverb wird konjugiert, während das Vollverb im Infinitiv ohne „zu“ am Ende des Satzes steht.
→ „Ich muss jeden Tag Deutsch lernen.“
→ „Du darfst heute länger aufbleiben.“
→ „Wir wollen ins Kino gehen.“
Modalverb als Vollverb
Einige Modalverben können auch ohne ein weiteres Verb im Satz stehen. Dann haben sie die Bedeutung eines Vollverbs.
→ „Ich mag dich.“
→ „Ich muss los.“
→ „Das Kind will nicht.“
Ersatzinfinitiv (Perfekt, Plusquamperfekt, Futur II)
In zusammengesetzten Zeitformen steht das Modalverb selbst im Infinitiv, während das Hilfsverb (haben oder werden) konjugiert wird.
→ „Ich habe arbeiten müssen.“
→ „Wir werden helfen müssen.“
Partizip II der Modalverben
Das Partizip II der Modalverben wird nur dann gebraucht, wenn das Modalverb als Vollverb steht:
→ „Ich habe dich immer gemocht.“
→ „Sie hat nicht gewollt.“
→ „Er hat lange gemusst.“
Wenn das Modalverb mit einem weiteren Vollverb kombiniert ist, greift stattdessen der Ersatzinfinitiv.
Passiv mit Modalverben
Das Passiv mit Modalverben wird gebildet mit: Modalverb (konjugiert) + Partizip II des Vollverbs + „werden“.
→ „Das Auto muss gewaschen werden.“
→ „Die Regeln sollen eingehalten werden.“
→ „Der Vertrag darf nicht verletzt werden.“
4. Konjugation der Modalverben
Die Modalverben sind unregelmäßig und unterscheiden sich in einigen Formen deutlich von den regelmäßigen Verben. Besonders auffällig ist der Vokalwechsel in den Singularformen und die Tatsache, dass in der 1. und 3. Person Singular keine Endung im Präsens steht.
Präsens
| Person | dürfen | können | mögen | müssen | sollen | wollen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ich | darf | kann | mag | muss | soll | will |
| du | darfst | kannst | magst | musst | sollst | willst |
| er/sie/es | darf | kann | mag | muss | soll | will |
| wir | dürfen | können | mögen | müssen | sollen | wollen |
| ihr | dürft | könnt | mögt | müsst | sollt | wollt |
| sie | dürfen | können | mögen | müssen | sollen | wollen |
Präteritum
Die Modalverben bilden ihr Präteritum mit dem Suffix -te und oft einem Ablaut (Vokalwechsel).
| Person | dürfen | können | mögen | müssen | sollen | wollen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ich | durfte | konnte | mochte | musste | sollte | wollte |
| du | durftest | konntest | mochtest | musstest | solltest | wolltest |
| er/sie/es | durfte | konnte | mochte | musste | sollte | wollte |
| wir | durften | konnten | mochten | mussten | sollten | wollten |
| ihr | durftet | konntet | mochtet | musstet | solltet | wolltet |
| sie | durften | konnten | mochten | mussten | sollten | wollten |
Konjunktiv II
Der Konjunktiv II wird häufig für höfliche Bitten, irreale Wünsche oder Vermutungen verwendet. Besonders verbreitet ist „möchte“ (von mögen) und „könnte“ (von können).
| Person | dürfen | können | mögen | müssen | sollen | wollen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ich | dürfte | könnte | möchte | müsste | sollte | wollte |
| du | dürftest | könntest | möchtest | müsstest | solltest | wolltest |
| er/sie/es | dürfte | könnte | möchte | nüsste | sollte | wollte |
| wir | dürften | könnten | möchten | müssten | sollten | wollten |
| ihr | dürftet | könntet | möchtet | müsstet | solltet | wolltet |
| sie | dürften | könnten | möchten | müssten | sollten | wollten |
Hinweis:
- möchte ist formal der Konjunktiv II von mögen, wird aber im Deutschen fast ausschließlich im Präsens als eigenständiges Modalverb für höfliche Wünsche gebraucht.
- Besonders gebräuchlich sind die Konjunktiv-II Formen könnte, dürfte, müsste und sollte.
5. Subjektive vs. objektive Bedeutung
Modalverben können nicht nur eine objektive Notwendigkeit oder Möglichkeit ausdrücken, sondern auch die subjektive Einschätzung des Sprechers. Deshalb unterscheidet man zwischen objektiver Bedeutung und subjektiver Bedeutung.
Objektive Bedeutung
Die objektive Bedeutung beschreibt die äußeren Umstände einer Handlung – also, ob sie erlaubt, notwendig oder möglich ist.
Beispiele:
→ „Du darfst ins Kino gehen.“ (Erlaubnis)
→ „Ich muss morgen früh arbeiten.“ (Notwendigkeit/Zwang)
→ „Er kann gut schwimmen.“ (Fähigkeit)
Subjektive Bedeutung
Die subjektive Bedeutung spiegelt die Einschätzung des Sprechers wider. Hier geht es nicht um objektive Regeln, sondern um Vermutungen oder Fremdaussagen.
Beispiele:
→ „Er muss der neue Lehrer sein.“ (logische Schlussfolgerung → Sprecher ist überzeugt)
→ „Das kann nicht stimmen.“ (Unmöglichkeit aus Sicht des Sprechers)
→ „Er soll sehr reich sein.“ (Wiedergabe eines Gerüchts oder einer Fremdaussage)
→ „Das dürfte richtig sein.“ (vorsichtige Vermutung)
| Modalverb | Objektive Bedeutung (Faktenlage) | Subjektive Bedeutung (Sprechereinschätzung) |
|---|---|---|
| müssen | Notwendigkeit/Zwang: Ich muss morgen arbeiten. | Schlussfolgerung: Das muss der Lehrer sein. |
| dürfen | Erlaubnis: Du darfst hier parken. | Wahrscheinlichkeit: Das dürfte passen. |
| können | Fähigkeit/Möglichkeit: Er kann schwimmen. | Vermutung: Er kann schon zu Hause sein. |
| sollen | Auftrag/Ratschlag: Ich soll dich grüßen. | Fremdaussage: Er soll sehr reich sein. |
| wollen | Wille/Absicht: Ich will nach Hause gehen. | Behauptete Aussage: Er will nichts gewusst haben. |
Merke:
- Objektiv: äußere Realität → Erlaubnis, Zwang, Möglichkeit.
- Subjektiv: Sprecherhaltung → Vermutung, Gerücht, logische Folgerung.
6. Sonderfall „möchten“
Das Wort möchten ist formal der Konjunktiv II von mögen. In der heutigen Sprache wird es jedoch fast ausschließlich im Präsens verwendet und hat sich zu einem eigenständigen Modalverb entwickelt. Sein wichtigster Zweck ist es, höfliche Wünsche oder Absichten auszudrücken.
- Höflicher Wunsch:
→ „Ich möchte einen Kaffee.“ - Freundliche Absicht:
→ „Wir möchten bald in den Urlaub fahren.“ - Vorschlag:
→ „Möchtest du mit uns ins Kino gehen?“
Das Modalverb wollen ist direkter und manchmal zu stark in der Ausdrucksweise. Möchten wird dagegen als höflicher und weicher empfunden.
| Ausdruck | Bedeutung/Wirkung | Beispielsatz |
|---|---|---|
| wollen | starker Wille/klare Absicht | Ich will ein Bier. |
| möchten | höflicher Wunsch, freundlicher Ton | Ich möchte ein Bier. |
Infobox – Merke:
- wollen = starker Wille, manchmal unhöflich.
- möchten = höflich, wird in Alltag und Service-Situationen bevorzugt.
- Für höfliche Bitten ist möchten fast immer die bessere Wahl.
7. Weitere modale Ausdrücke (Halbmodale)
Neben den klassischen Modalverben gibt es im Deutschen auch Verben, die eine ähnliche Funktion übernehmen. Diese werden oft als Halbmodale bezeichnet, da sie wie Modalverben die Bedeutung eines Vollverbs modifizieren, aber dabei mit „zu + Infinitiv“ stehen.
brauchen zu
- Bedeutung: Drückt Notwendigkeit oder Zwang aus, ähnlich wie müssen.
- Beispielsatz:
→ „Du brauchst keine Angst zu haben.“ (= Es ist nicht notwendig, Angst zu haben.)
scheinen zu
- Bedeutung: Drückt eine Einschätzung oder Vermutung des Sprechers aus, ähnlich wie ein subjektives Modalverb.
- Beispielsatz:
→ „Er scheint müde zu sein.“ (= Es wirkt so, als ob er müde ist.)
pflegen zu
- Bedeutung: Bezeichnet eine Gewohnheit oder regelmäßige Handlung.
- Beispielsatz:
→ „Er pflegt abends spazieren zu gehen.“ (= Er geht gewöhnlich am Abend spazieren.)
Weitere Beispiele für Halbmodale
- versuchen zu (Absicht): → „Sie versucht, Deutsch zu lernen.“
- drohen zu (Ankündigung, Gefahr): → „Das Schiff droht zu sinken.“
Infobox – Unterschied zu Modalverben:
- Modalverben stehen ohne „zu“ vor dem Infinitiv (Ich muss lernen.).
Halbmodale stehen immer mit „zu + Infinitiv“ (Ich brauche nicht zu lernen.).
8. Modalverben: Übungen mit Lösungen
Übung 1
Setzen Sie das passende Modalverb (dürfen, können, mögen, müssen, sollen, wollen) in die Lücken:
- Wir ______ heute ins Kino gehen. (Absicht)
- Kinder ______ hier nicht rauchen. (Verbot)
- Ich ______ sehr gut kochen. (Fähigkeit)
- Er ______ eine Tasse Kaffee. (Wunsch)
- Du ______ deine Hausaufgaben machen. (Notwendigkeit)
Übung 2
Konjugieren Sie das Modalverb in der passenden Person und Zeit:
- Ich ______ (können, Präteritum) gestern nicht kommen.
- Er ______ (müssen, Präsens) morgen früh arbeiten.
- Wir ______ (dürfen, Konjunktiv II) hier eigentlich nicht parken.
- Ihr ______ (mögen, Präsens) italienisches Essen sehr.
Übung 3
Bestimmen Sie, ob das Modalverb objektiv (äußere Realität) oder subjektiv (Sprechereinschätzung) verwendet wird:
- Das muss der neue Nachbar sein.
- Ich muss morgen ins Büro gehen.
- Er soll in Berlin wohnen.
- Du darfst ins Kino gehen.
- Das kann nicht stimmen.
Lösungen
zu Übung 1
- wollen – Wir wollen heute ins Kino gehen.
- dürfen – Kinder dürfen hier nicht rauchen.
- können – Ich kann sehr gut kochen.
- möchte/mögen – Er möchte eine Tasse Kaffee.
- müssen – Du musst deine Hausaufgaben machen.
zu Übung 2
- konnte – Ich konnte gestern nicht kommen.
- muss – Er muss morgen früh arbeiten.
- dürften – Wir dürften hier eigentlich nicht parken.
- mögt – Ihr mögt italienisches Essen sehr.
zu Übung 3
- subjektiv (Schlussfolgerung)
- objektiv (Notwendigkeit)
- subjektiv (Fremdaussage)
- objektiv (Erlaubnis)
- subjektiv (Unmöglichkeit)
Weitere Wissensartikel zum Thema entdecken
Wollen Sie Ihr Verständnis für Wortbildung und grammatische Strukturen vertiefen? In unserem Wissensbereich finden Sie zusätzliche Beiträge, die Ihnen helfen, die deutsche Sprache noch besser zu durchdringen:
Zusätzlich bieten wir Deutschkurse sowohl online als auch vor Ort an. Mit gezielter Prüfungsvorbereitung und erfahrener Betreuung durch unsere DaF-Lehrkräfte können Sie Ihre Sprachfertigkeiten Schritt für Schritt erweitern.